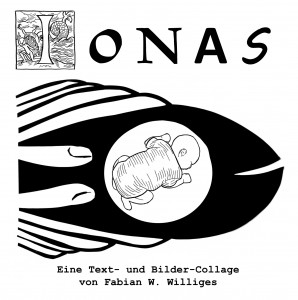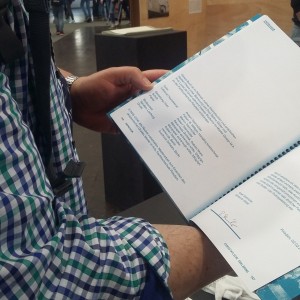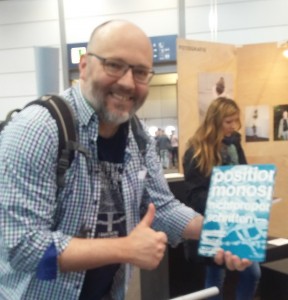Am 8. Mai 1873 starb der liberale Ökonom und Philosoph John Stuart Mill. Er war ein früher Verfechter der Emanzipation der Frau, überzeugter Anhänger des Utilitarismus und Schöpfer des Wortes Dsytopie zur Bezeichnung einer negativen Utopie.
Heute, am Tag der Befreiung, der, wie Richard von Weizsäcker 1984 sagte, auch ein Tag der Befreiung für Deutschland vom menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft war, möchte ich einen wichtigen Satz von Mill herausheben. Er ist aus seinem Werk On Liberty (1859):
That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.
J. S. Mill nennt dies ein wirklich einfaches Prinzip (one very simple principle). Doch heute reiben wir uns die Schläfen wund, wann und wie denn nun die Freiheit eines Individuums eingeschränkt werden kann, bzw. wann auf offiziellem Weg ermittelt werden darf, ob ein solcher Fall eingetreten sei.
Ich spiele selbstverständlich auf Jan Böhmermann an, dessen Interview in der Wochenzeitung „Die Zeit“ gerade in aller Munde ist. Dem manchmal geistreichen Unterhaltungskünstler hat die große Öffentlichkeit nicht gut getan. Er versteigt sich zu einer Merkel-Kritik, die nur zeigt, dass er – wie viele – den eigentlichen Kern der Sache nicht verstanden hat. Von großen Teilen der Bevölkerung erwarte ich ja nichts anderes. Aber Böhmermann hätte die letzten Tage zum Nachdenken nutzen können.
Filetiert habe die Kanzlerin den Moderator und einem nervenkranken Despoten zum Tee serviert. Na, das klingt jetzt aber dramatisch. Frau Merkel bekannte, dass das eigentliche Schmähgedicht für sie bewusst verletzend sei. Sie sagte dies dem Präsidenten der Türkei, aber sie sprach doch nicht ex cathedra. Ein solcher Satz hat, auch aus dem Munde der Bundeskanzlerin, keine konstituierende Wirkung. Und dass die Regierung letztendlich ein Verfahren zur Prüfung zulässt, so wie es in geltenden Gesetzen vorgesehen ist, lässt sich in meinen Augen schwer zu einem haltbaren Vorwurf nutzen.
Einen deutschen Ai Weiwei habe Angela Merkel aus ihm gemacht, sagt Böhmermann weiter. Da kann ich ihn beruhigen. Es gibt wohl nichts, was die Kanzlerin machen oder sagen könnte, um Böhmermanns Niveau zu heben, schon gar nicht auf das des großen Ai Weiwei. Selbstverständlich ist eine Voruntersuchung und ein letztendliches Strafverfahren keine angenehme Sache. Und über die menschliche Not Böhmermanns möchte ich mich nicht erheben. Ich glaube aber, Ai Weiwei wäre deutlich glücklicher, wenn er all seine gegen ihn gerichteten Ermittlungen und Verfahren in Deutschland und nach deutschem Recht erdulden müsste. Das sollten wir nicht vergessen.
Wir leben nicht in einer Welt der unbegrenzten Freiheit, die persönliche Freiheit ist genau so beschränkt wie die Presse- und die Kunstfreiheit. Und das ist gut so. Denn die Freiheit, die wir haben, soll für alle gelten.
Eins möchte ich noch sagen: Ich hoffe, dass Jan Böhmermann freigesprochen wird. Ich denke, dass er diese Nummer mit dem Schmähgedicht recht geschickt eingefädelt hat. Ihm liegt – und da muss ich eine Polemik zum Niveau Böhmermanns leicht revidieren – fast etwas Faustisches inne. Wir erinnern uns an der Tragödie zweiten Teil. In seinem letzten Monolog sagt Faust:
Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke dürft ich sagen:
Verweile doch, du bist so schön!
Diese letzten Worte lassen Mephisto an den Sieg der Wette glauben. Doch der Teufel hat nicht genau hingehört; Faust hat im Konjunktiv gesprochen. Ähnlich verhält es sich mit dem Schmähgedicht. Natürlich kann man nicht unter der Überschrift „Ich zeige euch mal, was man nicht machen darf“ ungestraft einen Mord begehen. Aber auf der verbalen Ebene ist ein solches Verfahren statthaft. Sonst befinden wir uns in einer von Monty Python beschriebenen Szene: „Es ist verboten, Jehova zu sagen!“ – Na, wer hat jetzt „Jehova“ gesagt?
Aber das gerichtlich untersuchen zu lassen, muss erlaubt bleiben. Wir leben in einem Rechtsstaat. Der wirkt manchmal etwas schwerfällig. Der Lynchmob ist da deutlich agiler. Möchte jemand tauschen?
Die Freiheit jedes Einzelnen zu bewahren und vor ausufernden Handlungen anderer zu schützen, ist ein fortwährender Aushandlungsprozess. Jan Böhmermann ist dieser Tage zu einem prominenten Beispiel geworden, einen tragischen Helden macht ihn das aber noch lange nicht. Der, nämlich Faust, sagte kurz vor den oben zitierten Worten noch den Satz, mit dem ich meinen Eintrag abschließen möchte:
Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss.