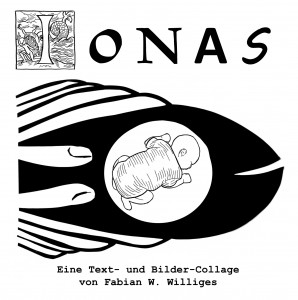Nun habe ich ganz den 20. Juli 1944 vergessen, dessen man in den heutigen Zeiten (Stichwort Freital) doch gedenken sollte. Das große Jubiläum im letzten Jahr hatte ich dafür feierlich begangen, indem ich eine Sonderausstellung im Militärhistorischen Museum in Dresden besuchte. Nun ist Attentat auf Hitler. Stauffenberg und mehr eine Wanderausstellung. Bis zum 13. September 2015 ist sie in Ludwigsburg (bei Stuttgart) zu sehen. Sie besteht zu großen Teilen aus dem, was der Museumspädagoge Flachware nennt. Es ist also viel zu lesen. Aber mich haben einige der Originalbriefe beeindruckt, die dort gezeigt werden.
Links
mhmbw.de – Militärhistorisches Museum in Dresden
garnisonmuseum-ludwigsburg.de – Garnisonmuseum in Ludwigsburg (aber das sagt ja schon die URL)
Ich wollte mich heute auf Maria Magdalena stürzen; denn heute ist ihr Namenstag, der von nahezu allen Kirchen begangen wird – allerdings in unterschiedlicher Intensität. Maria Magdalena wird im Deutschen auch Maria von Magdala genannt. Das ist kein Adelstitel, sondern eine Herkunftsbezeichnung. Der Name Maria ist zur Zeit Jesu einfach zu häufig gewesen. An Beinamen zur Identifizierung fehlt es unserer Maria aber nun wirklich nicht. Lediglich Maria, die Mutter Jesu, hat noch ein paar mehr.
Maria Magdalena ist eine höchstwahrscheinlich historische Person aus einem Dorf am westlichen Ufer des See Genezareth, was heute unter dem Namen Migdal bekannt ist. Sieben Dämonen soll Jesus ihr ausgetrieben haben, bevor sie selbst eine Jüngerin Jesu wurde. Sie wird an einigen Stellen in den Evangelien erwähnt. Sie ging mit nach Jerusalem, war Zeugin der Kreuzigung und der Auferstehung. Der Religionswissenschaftler David Flusser entwickelte eine Theorie, nach der Maria Magdalena dem Evangelisten Lukas zugearbeitet hätte. Hippolyt von Rom nannte sie bereits im dritten Jahrhundert die Apostelin der Apostel.
Die Geschichte der anonymen Sünderin, die Jesus die Füße wusch und salbte, wurde seit Papst Gregor I. mit Maria Magdalena assoziiert. Aus der Sünderin wurde mit der Zeit eine Prostituierte. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden Besserungsanstalten für gefallene Mädchen Magdalenenheime genannt.
In einigen apokryphen Schriften gnostischer Tradition wird Maria Magdalena als Gefährtin oder gar Ehefrau Jesu bezeichnet. In popular- und pseudowissenschaftlichen Artikeln und Büchern wurde die kühne These aufgestellt, dass Maria mit Jesus nach Frankreich ausgewandert sein soll. Die Nachfahren bildeten dann das Haus der Merowinger.
Das aus Frankreich stammende Kleingebäck in Form einer Jakobsmuschel trägt seinen Namen Madeleine nur mittelbar der biblischen Gestalt wegen. Die Köchin am herzoglichen Hof zu Lothringen, die das Gebäck erfand, soll schlicht so geheißen haben. Aber sie stammte gewiss aus einer katholisch geprägten Familie.
Während es gerade schwül-warm ist über Leipzig, möchte ich zwei Bauernweisheit zitieren:
An Magdalena regnet’s gern, weil sie weinte um den Herrn.
Und in diesem Zusammenhang vielleicht ein wenig frustrierend:
Regnet’s am St. Magdalentag, folgt gewiss mehr Regen nach.